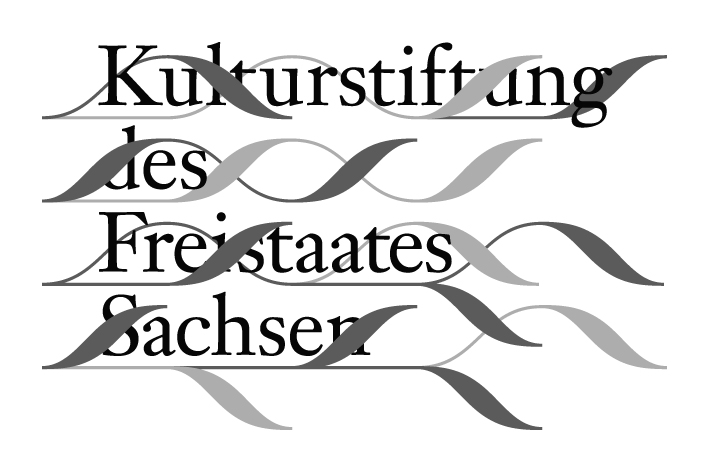KV – Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V.
Kolonnadenstraße 6
04109 Leipzig
kv.kunstvereinleipzig(at)gmail.com
Öffnungszeiten bei Ausstellungen:
MI 14—18
FR + SA 16—20
Bitte Mundschutz mitbringen.
Aktuell / Vorschau
Cultivation Techniques
Eröffnung
Donnerstag, 25.02.
Ausstellung
26.02.—15.04.
Online Event jeden Freitag
Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė
Cosima zu Knyphausen
Theresa Zwerschke
Hjördis Lyn Behncken
Benedikt Kuhn
Cultivation Techniques ist eine Gruppenausstellung, die innerhalb des Jahresprogrammes
Enzyklopädie des
KV — Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V. realisiert wird und bei der Arbeiten der Künstlerinnen
Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė und Malereien von Cosima zu Knyphausen in einem Diorama in den Schaufensterscheiben des KV und Beiträge von Theresa Zwerschke, Hjördis Lyn Behncken und Benedikt Kuhn, online, aufeinander treffen.
Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Konstituierung von Wirklichkeiten im Zeitalter der Multitude, aber auch des Postfaktischen in dem Sinne, dass der unsichtbare Erzähler einer westlich-hegemonialen Geschichtserzählung entthront wird, um sich der Etablierung habitueller Umsicht unter kritischer Einbeziehung des Subjekts zu widmen.
| A | Artistic Research |
| Aufmerksamkeitsdefizitkultur |
| B | Bildungslücke |
| Black Mountain College |
| Blinder Fleck |
| C | Chaos |
| CIAD |
| D | Darknet |
| Deep State |
| Derive |
| Diskretion |
| DIY |
| E | Elfenbeinturm |
| Experiment |
| F | Fröbel |
| Fußnote |
| G | Gedächtnistheater |
| Gordischer Knoten |
| Gossip |
| H | Hacker |
| Halluzination |
| Human Resource |
| Hochstapler |
| I | IBM |
| Ikonoklasmus |
| J | Jeopardy |
| K | Kognitiver Kapitalismus |
| Kollektives Trauma |
| Körperwissen |
| Kulturelles Gedächtnis |
| L | Labor |
| Logik |
| LSD |
| LTI |
| M | Meinung |
| Mind Palace |
| Minecraft |
| Mnemosyne |
| Musée imaginaire |
| N | Neuro-Science |
| News Cycle |
| Nichtwissen |
| O | Objektivität |
| Orakel von Delphi |
| Ordnung |
| P | Paradebeispiel |
| Perspektive |
| Perzeption |
| Projektion |
| Q | q. e. d. |
| Queer |
| Quelle |
| Quiz |
| R | Reizüberflutung |
| Rhizom |
| Russels Teekanne |
| S | Schule des Lebens |
| Science & Fiction |
| Simulation |
| Sinnliche Wahrnehmung |
| T | Technologien des Selbst |
| Terminologie |
| Theater der Natur und Kunst |
| Theorie & Praxis |
| Tools |
| U | Universalgelehrte |
| V | Vergessen |
| Verschwörung |
| Visualisierung |
| Visuelle Argumentation |
| W | Was ist was |
| Wer wird Millionär? |
| Willi wills wissen |
| Xanadu |
| X | Zaubereiministerium |
| Z | Zauberkugel |
| Zensur |
| Zirkelschluss |
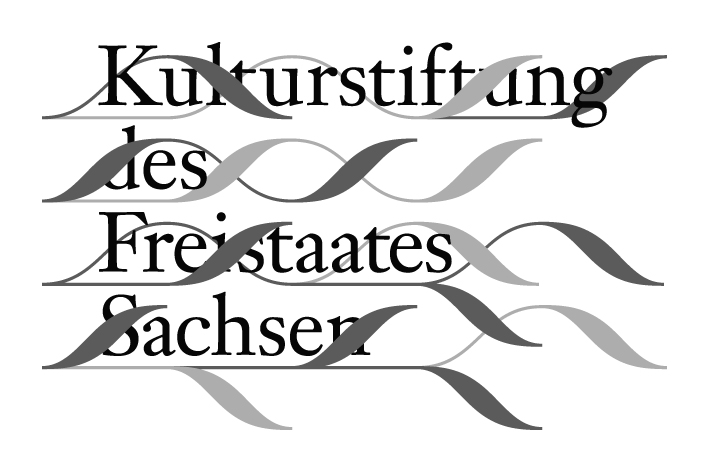

Archiv 2020
Die Ausstellungen Symposion, hidden labor across und Die Antwort kommt sind Teil des Projekts K—V Enzyklopädie.
Die Antwort kommt
Eröffnung
Donnerstag, 29.10., 16—21 Uhr
Ausstellung
30.10.—15.12.
Özlem Altin
Antonia Baehr
Lucile Desamory
Der Mensch ist in besonderer Form mit den Dingen verbunden – sie sind Wissensspeicher, besitzen eine Biografie, verkörpern Beziehungen und stehen häufig als Stellvertreter*innen für eine symbolische Ordnung. Folglich können Dinge als Akteur*innen eine Handlung vollziehen. Eine Ausstellung ist Teil dieses Systems, da sie mit Menschen und Dingen – ob mit Kunstwerken oder Dokumenten – Geschichten erzählt. Dazwischen liegen das Nichtgesagte und das Nichtgezeigte gleichermaßen präsent. Dass sie dieses Dazwischen beschreiben und klassische Ordnungssysteme hinterfragen, verbindet das bildnerische und performative Denken und Handeln der drei beteiligten Künstlerinnen.
Kuratiert von Susanne Weiß
Preview Tombola Beiträge
20.—23.10.2020, 16—19 Uhr
Tombola Verlosung
Samstag, 24.10., 19—21 Uhr
Nietenblatt von Henrike Naumann
Der KV ist ein Ort zeitgenössischer Kunst und der Teilhabe. Realisiert wird das Programm durch Mitgliedsbeiträge, öffentliche Fördergelder, prekäre Arbeitsverhältnisse und ehrenamtliches Engagement. Um die Ausstellungen, Veranstaltungen und künstlerischen Neuproduktionen finanzieren zu können, veranstalten wir wieder die jährliche Tombola. Die von den uns unterstützenden KünstlerInnen gespendeten Werke machen die Tombola erst möglich. Der Lospreis von 60 Euro erlaubt es einem breiten Publikum, Zugang zu außergewöhnlichen Kunstwerken zu erhalten und gleichzeitig den KV zu unterstützen.
Film-Screening
Donnerstag, 15.10., 20 Uhr
Bitte für den Zoom-Live-Stream
hier anmelden:
Chetna Vora
Oyoyo (1980) is a cine-portrait of an educational internationalism with
students from Chile, Guinea-Bissau, the Mongolian Soviet Republic, Cuba
and Bulgaria studying economy at the “Hochschule für Ökonomie Berlin-
Karlshorst” in the late 1970s. The director is the Indian filmmaker Chetna
Vora who mobilizes the film-camera as a means to listen to the problems
that the students encounter in their education, what they miss in the GDR,
and how they imagine their future. The candid conversational scenes situated
in the students’ dormitory in Berlin-Karlshorst alternate with music by
Cuban songwriter Silvio Rodriguez, the Brazilian singer Nara Leão and songs
in Cape Verdean Créole. As a daughter of a communist communist family
from Palitana in Gujarat in India, Chetna Vora came to Berlin in the mid-
1970s to study film at the Konrad Wolf Film Academy in Potsdam-Babelsberg.
Part of hidden labor across
hidden labor across
(inter∞note)
Eröffnung
Samstag, 22.8., 14—22 Uhr
Ausstellung
22.8.—17.10.2020
Vinit Agarwal
Joo Young Hwang
Aarti Sunder
Ruth Wolf-Rehfeldt
Chetna Vora
Hidden Labor Across (inter∞note) beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Idee des Internationalismus als politisches Konzept des 20. Jahrhundert in aktuellen Debatten um Globalisierung von Arbeit, Technologie und Wissen eine unvollendete Narration darstellt. Es ist die erste kuratorische Artikulation des internationalen Forschungsprojektes Decolonizing Socialism. Entangled Internationalism.
Kuratiert von Doreen Mende
Eröffnung
Freitag, 12.6., 14—22 Uhr
Ausstellung
13.6.—25.7.2020
Heike Geißler
Antye Guenther
Sidsel Meineche Hansen
Emanuel Mathias
Agnes Meyer-Brandis
Alexander Pannier
Mit dem Auftakt der K—V Enzyklopädie zum Thema Wissen wird der Versuch einer Rekonstruktion eines Begriffs unternommen, der heute ein institutionalisiertes und ritualisiertes Format der Wissensproduktion beschreibt. Im ursprünglichen Sinne des griechischen Symposions als eine kollektiv-ästhetische Erfahrung stehen hier nicht diskursive Expertise, sondern künstlerische Positionen im Dialog. Während die eingeladenen KünstlerInnen die Adaption (natur-)wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstände und Instrumentarien eint, kommt deren Neuperspektivierung in unterschiedlichster Weise zum Ausdruck.
KV Support
Überfahrt
(Spector Books, Volte Expanded #4)
Buchpremiere und Eröffnung
wegen COVID-19 abgesagt
Ausstellung 28.3.—8.4.20
wegen COVID-19 abgesagt
Roman Ehrlich
Michael Disqué
Roman Ehrlich (Text)
Michael Disqué (Bild)
Matthias Krieg (Ton)
Jörn Dege (Moderation)
Zwei Künstler reisen 40 Tage mit einem Containerschiff von Hamburg nach Qingdao, China. Entstanden ist daraus ein Text-Bild-Essay über die politischen Bedingungen des weltweiten Güterverkehrs, die brüchigen Narrative der Seefahrt sowie den Verlust der Sprache und der Festlandswirklichkeit.
KV Support
Die Dinge in Bewegung
Jens-Martin Triebel
Ausstellung 14.—16.2.20
Auf der Oberfläche der Weltmeere werden Unmengen an Waren verschoben. Die Natur muss sich der kulturellen Ordnung unterwerfen. Doch die Farben und Temperaturen der Weltmeere verändern sich. Dinge die einst im Meer versanken und für verloren geglaubt wurden, tauchen unerwartet wieder auf.
Ein Dialog zwischen Mensch und Meer entsteht.
Die Installation bringt Fragmente dieses Gespräches zum Vorschein und blickt auf den Umgang mit den uns umgebenden Dingen.
Jens-Martin Triebel (*1985) studiert in der Fachklasse für Bildende Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Im Rahmen des Diploms zeigt er seine multimediale Installation: Die Dinge in Bewegung.